Blasensteine stellen eine recht häufige urologische Erkrankung dar, die erhebliche Auswirkungen auf die Kontinenz und die Blasenentleerung haben kann. Diese mineralischen Ablagerungen, die sich in der Harnblase bilden, unterscheiden sich in ihrer Größe, Struktur und Zusammensetzung und können zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen. Im Folgenden werden die Ursachen, Symptome, Diagnose sowie die Behandlungsmöglichkeiten von Blasensteinen und deren Einfluss auf die Kontinenz und Blasenentleerung genauer beleuchtet.
Ursachen von Blasensteinen
Blasensteine entstehen in der Regel durch eine Vielzahl von Faktoren, die das Gleichgewicht der in der Blase enthaltenen Substanzen stören. Dazu gehören:
- Harnabflussstörungen: Eine der häufigsten Ursachen sind Obstruktionen im Harntrakt, oft durch eine Vergrößerung der Prostata bei Männern oder durch Harnröhrenverengungen.
- Restharnbildung: Unvollständige Blasenentleerung kann zur Bildung von Blasensteinen führen, da konzentrierter Harn in der Blase verbleibt.
- Infektionen: Harnwegsinfektionen können das Risiko erhöhen, indem sie die chemische Zusammensetzung des Urins verändern.
- Fremdkörper: Gegenstände in der Blase, wie z.B. Katheter, können als Kristallisationskeime für Steine dienen.
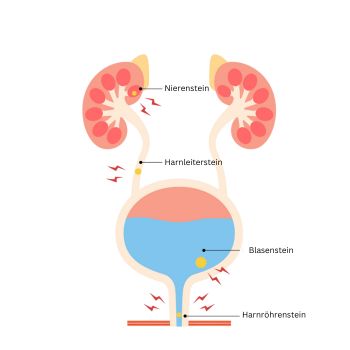 Symptome
Symptome
Die Symptome von Blasensteinen sind vielfältig und hängen von der Größe und Position der Steine ab. Häufig treten auf:
- Häufiges Wasserlassen: Steine können die Blasenkapazität verringern, was zu häufigem Harndrang führen kann.
- Schmerzen und Brennen: Typischerweise im Unterbauch oder beim Wasserlassen.
- Hämaturie: Präsenz von Blut im Urin aufgrund von Reizungen oder Verletzungen der Blasenschleimhaut.
- Unterbrechung des Harnflusses: Steine, die den Blasenauslass blockieren, können plötzliche Unterbrechungen und schwachen Harnstrahl verursachen.
Einfluss auf Kontinenz und Entleerungsstörungen
Blasensteine haben unmittelbar starken Einfluss auf die Kontinenz (Fähigkeit, Harn willentlich zurückzuhalten) und auf die Entleerung der Blase. Diese Auswirkungen können sich wie folgt darstellen:
- Harninkontinenz: Durch die mechanische Reizung und Schädigung der Blasenschleimhaut oder durch eine Blockade kann eine unwillkürliche Blasenentleerung auftreten, insbesondere bei Störungen der Speicherfunktion der Blase.
- Dranginkontinenz: Blasensteine können den Drang zum Wasserlassen steigern und zu einer Notwendigkeit führen, sofort die Toilette aufsuchen zu müssen.
- Restharnbildung und Überlaufinkontinenz: Tatsächlich ist es möglich, dass eine vollständige Entleerung der Blase verhindert wird, was zu einer kontinuierlichen Tröpfchenbildung (Überlaufinkontinenz) führt und das Risiko von Infektionen weiter erhöht.
Diagnose
Die Diagnostik von Blasensteinen erfolgt in der Regel durch:
- Anamnese und körperliche Untersuchung: Erfassung der Symptomatik und Abtasten des Unterbauchs.
- Bildgebende Verfahren: Ultraschall, Röntgen oder CT-Scans können Steine sichtbar machen.
- Urinanalyse: Aufschluss über Infektionen, Blut oder kristalline Bestandteile.
- Zystoskopie: Endoskopische Untersuchung der Blase zur direkten Identifikation von Steinen.
Behandlungsmöglichkeiten
Behandlungsmöglichkeiten richten sich nach Größe, Lage und Menge der Blasensteine sowie dem allgemeinen Gesundheitszustand des Betroffenen und umfassen:
- Medikamentöse Therapie: Bei kleinen Steinen können Medikamente helfen, die Steine aufzulösen oder deren Ausstoß zu fördern.
- Blasenspülung: Manchmal können Steine durch Spülung der Blase mit speziellen Lösungen entfernt werden.
- Operation: Größere Steine oder komplizierte Fälle erfordern möglicherweise einen chirurgischen Eingriff wie die Zystolitholapaxie (minimally invasive Methode) oder die Zystolithotomie (offene Operation).
- Lithotripsie: Ein Verfahren, bei dem Schallwellen genutzt werden, um Steine zu zertrümmern, damit sie über den Urin ausgeschieden werden können.
Prävention
Zur Vorbeugung von Blasensteinen sollten folgende Maßnahmen berücksichtigt werden:
- Hydration: Ausreichend Wasser trinken, um die Urinkonzentration zu verdünnen.
- Regelmäßige Blasenentleerung: Vor allem für Personen mit Harnabflussstörungen oder Restharnbildung.
- Diätetische Anpassungen: Eine ausgewogene Ernährung, möglicherweise mit Begrenzung von Calcium- und Oxalatzufuhr, je nach individueller Disposition.
- Behandlung von zugrundeliegenden Erkrankungen: Insbesondere Harnwegsinfektionen oder Prostataprobleme.
Blasensteine können erhebliche negative Auswirkungen auf die Kontrolle über die Blasenentleerung und die Fähigkeit zur Kontinenz haben. Eine frühzeitige Diagnose und geeignete Therapie sind entscheidend, um Folgeschäden und dauerhafte Funktionsstörungen der Blase zu verhindern. Vorbeugende Maßnahmen und regelmäßige ärztliche Kontrollen können das Risiko der Bildung von Blasensteinen und damit verbundener Entleerungsstörungen signifikant reduzieren.
